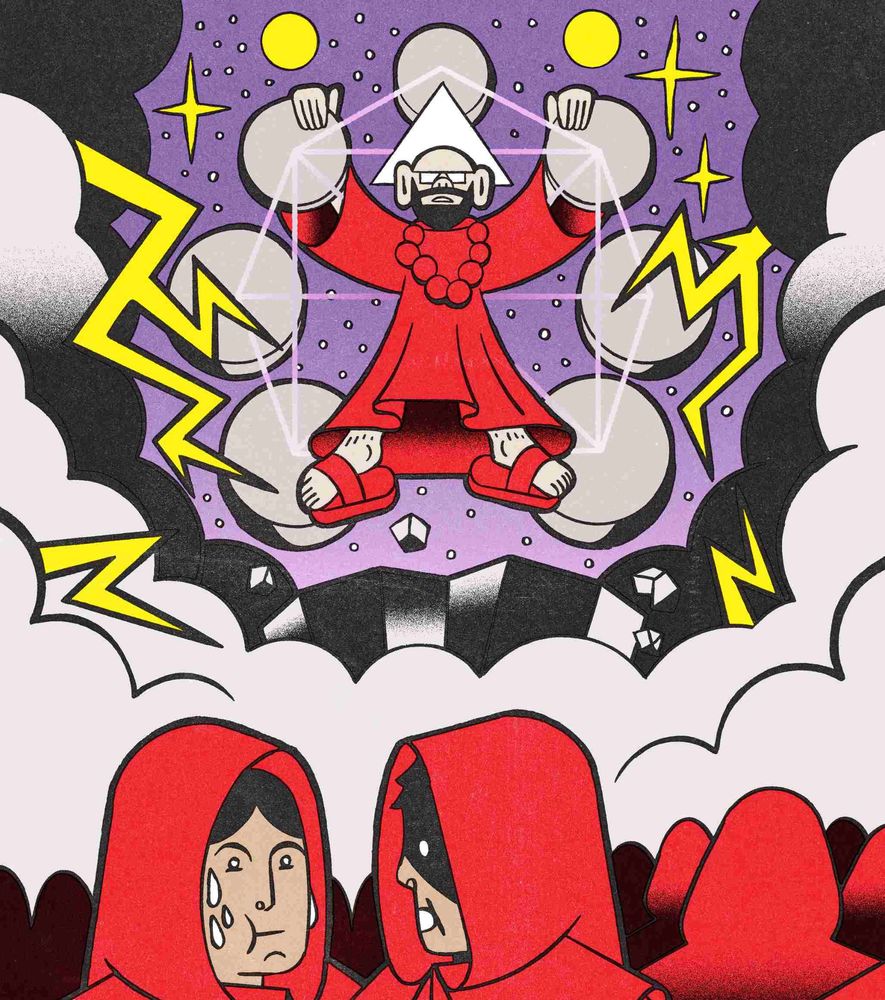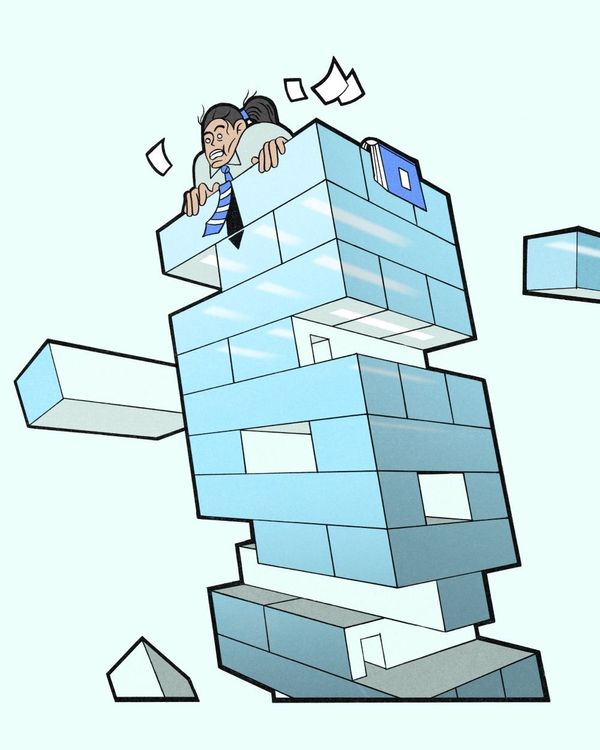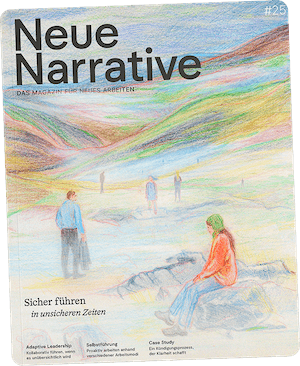In vielen Unternehmen wird zu wenig über psychische Erkrankungen gesprochen. Das gilt auch für die Posttraumatische Belastungsstörung. Wie kann eine rücksichtsvolle Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen aussehen?
Die Begriffe „Trauma“ und „Trigger“ werden in unserem alltäglichen Sprachgebrauch aktuell überstrapaziert. Wir hören oder sagen Sätze wie: „Das Meeting hat mich total getriggert“, oder: „Mein Chef traumatisiert mich mit seinen Mails“. Wenn wir in der Psychologie dagegen von einem traumatischen Ereignis sprechen, hat eine Person eine Situation von katastrophalem Ausmaß erlebt (oder überlebt), die ihre Wahrnehmung von der Gesellschaft, ihren Mitmenschen und sich selbst verändern kann. Die Person ist nicht mehr die, die sie war, bevor das Ereignis passiert ist. Ein Teil ihres Ichs wurde erschüttert.
Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sind in Deutschland pro Jahr rund 1,5 Millionen Erwachsene von einer akuten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) betroffen. Ausgelöst werden kann diese z.B. durch Folter, Krieg, schwere Unfälle, sexualisierte Gewalt oder Terroranschläge. Potenziell traumatische Erlebnisse sind nicht selten, auch Geburten, Jobverluste, Todesfälle und Trennungen zählen dazu. Expert*innen unterscheiden jedoch zwischen verschiedenen Trauma-Arten, und nicht jedes traumatische Erlebnis führt zu einer Trauma-Folgestörung: „Dass Menschen auf ein traumatisches Erlebnis mit Belastung und Stress reagieren, ist grundsätzlich normal. Die Art des Traumas, die Schwere der Traumatisierung und die Dauer der Symptome sind dann aber entscheidend für eine klinische Diagnose einer PTBS“, sagt Benthe Untiedt, Psychologin bei SHITSHOW – Agentur für psychische Gesundheit.
Nicht jedes traumatische Ereignis führt zu einer Folgestörung

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative
Magazin kostenlos lesenWer akut traumatisiert ist, fühlt sich erst einmal wie in ständiger Alarmbereitschaft, ist unruhig, nervös, schreckhaft oder auch reizbar. Weitere Symptome können z.B. Albträume, Schlafstörungen, Erinnerungslücken oder selbstverletzendes Verhalten sein. Das Gehirn steht kurz nach einem traumatischen Erlebnis unter Dauerstress – es versucht, die Eindrücke zu verarbeiten. Gelingt das, z.B. mithilfe von sozialer Unterstützung, klingen die Symptome ab. Wenn die Verarbeitung nicht gelingt, erleben Betroffene das traumatische Erlebnis beispielsweise in sogenannten Flashbacks immer wieder, obwohl Betroffene versuchen, Gedanken, Situationen und Erinnerungen an das Erlebnis zu vermeiden. Ausgelöst werden kann das durch ganz individuelle Trigger, zum Beispiel spezifische Gerüche, Geräusche, Orte, Gesichter oder auch Dunkelheit. Wenn diese Symptome mindestens einen Monat andauern, spricht man von einer akuten Posttraumatischen Belastungsstörung. Ab drei Monaten spricht man von einer chronischen PTBS, die therapeutisch behandelt werden sollte, weil sich das Risiko für Folgeerkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen mit der Zeit erhöht.
Stilles Leiden: Berufsrisiko PTBS
Die Diagnosekriterien von PTBS waren nicht immer so eindeutig. Während des Ersten Weltkriegs litten viele Soldaten am sogenannten Kriegszittern. Mediziner behaupteten damals, es handele sich dabei um Simulation oder Willensschwäche. Der Neurologe Hermann Oppenheim erkannte, dass es sich bei dem Zittern um ein psychisches Symptom infolge der Kriegserfahrungen handelte – und setzte sich dafür ein, es als solches zu behandeln.1 Seine Abhandlung über die traumatische Neurose wurde damals massiv kritisiert und verspottet. Heute wissen wir nicht nur, dass es PTBS gibt, sondern auch, dass das Risiko für die Erkrankung in manchen Berufen deutlich höher ist als in anderen. Dazu gehören neben Soldat*innen auch Journalist*innen, die in Krisengebieten tätig sind, Polizist*innen, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter*innen sowie Ärzt*innen und Psycholog*innen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten. Bei Rettungssanitäter*innen liegt die Lebenszeitprävalenz sogar bei 36 Prozent.2 Das heißt: 36 Prozent aller Rettungssanitäter*innen haben in ihrem Leben schon mal eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. PTBS wird vom Bundessozialgericht für diese Berufsgruppe deshalb auch wie eine Berufskrankheit anerkannt.
Aber natürlich erleiden Menschen nicht nur im Beruf Traumata. „Zu den vulnerablen Bevölkerungsgruppen gehören auch Flüchtlinge und Asylsuchende, die sich bei ihrer Ankunft in Deutschland oftmals in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden. […] Die Rate für PTBS ist bei dieser Personengruppe im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um das Zehnfache erhöht“, sagt Iris Hauth, Präsidentin der DGPPN.3
Auch sexualisierte Gewalt als Auslöser für PTBS ist wichtig zu nennen, besonders, weil sie so verbreitet ist: Ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse sind/waren von sexualisierter Gewalt betroffen (hauptsächlich außerhalb der Schule). Besonders hoch ist das Risiko, wenn eine Behinderung vorliegt.4.
Manchmal zeigen sich die Auswirkungen dieser traumatischen Erlebnisse auch erst im Erwachsenenalter. Einige Betroffene von PTBS sind über längere Zeit nicht arbeitsfähig. Manche arbeiten weiter und tragen über mehrere Jahre hinweg stille Kämpfe mit sich selbst aus, ohne dass Kolleg*innen von ihrer Traumatisierung erfahren.
Verschiedene Arten von Trauma
Was Menschen in Organisationen tun können
Ob die Kolleg*innen von der eigenen Traumatisierung wissen sollen, muss am Ende jede*r Betroffene selbst entscheiden. Doch für die, die ihre Erkrankung teilen möchten, sollte es Räume im Unternehmen dafür geben. Vielen Personen fällt es schwer, über ihr Trauma zu sprechen. Um sich öffnen zu können, brauchen Betroffene eine entsprechende Unternehmenskultur: „Ich würde nicht pauschal jeder Person dazu raten, über die eigene PTBS oder Traumafolgestörung zu sprechen“, sagt Benthe Untiedt. „Wie mit so einer Information am besten umgegangen wird, hängt auch stark von der Kultur und den Strukturen im Unternehmen ab.“ In Organisationen mit starker Ellenbogen-Mentalität und wenig psychologischer Sicherheit kann ein Outing die Tür für Ausgrenzung und Diskriminierung öffnen. Das kann die Situation der Betroffenen noch verschlechtern.
„Ich würde nicht pauschal jeder Person dazu raten, über die eigene PTBS oder Traumafolgestörung zu sprechen“
Benthe Untiedt, Psychologin
Wenn eine Person sich dazu entscheidet, über ihr Trauma zu sprechen, sollten Kolleg*innen behutsam nachfragen, was ihre individuellen Bedürfnisse im Umgang mit dem Trauma sind. Diese können sich je nach Krankheitsphase auch unterscheiden. Offene Kommunikation vereinfacht die Zusammenarbeit für alle Beteiligten: Wenn Kolleg*innen wissen, was Trigger sind, verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich retraumatisierend äußern oder verhalten, und Betroffene können sich darauf verlassen, dass an ihrem Arbeitsplatz rücksichtsvoll und sensibel mit ihrer Erkrankung umgegangen wird.
Für manche Betroffene von PTBS, deren Trauma aus dem privaten Bereich kommt, ist der Arbeitsplatz im Vergleich zum Privatleben ein sicherer Rückzugsort, in dem sie Normalität erleben und nicht ständig mit ihren Symptomen konfrontiert werden. Ihre Arbeit hilft ihnen, Abstand von ihren belastenden Erinnerungen zu bekommen – zumindest zeitweise. Ein teaminterner Code of Conduct stellt sicher, dass dies auch so bleibt: Er regelt, welches Verhalten in der Organisation (nicht) erwünscht ist. Davon profitieren alle Menschen in der Organisation. Teams können ihren Code of Conduct um potenzielle Trigger erweitern. Das können z.B. Dinge wie Körperkontakt, gewaltvolle Sprache oder das Ansprechen von traumarelevanten Themen wie sexualisierte Gewalt oder Unfälle sein. Ein Code of Conduct, der sensibel mit psychischen Erkrankungen wie PTBS umgeht, kann z.B. so aussehen:
Code of Conduct
- Respekt und Empathie: Wir behandeln alle Menschen in unserer Organisation mit Respekt und Empathie. Wir erkennen an, dass jede*r unterschiedliche Erfahrungen und Hintergründe hat, die seine*ihre mentale Gesundheit beeinflussen können.
- Offene Kommunikation: Wir ermutigen einander zu offener Kommunikation über mentale Gesundheit. Jede*r sollte sich sicher fühlen, Bedürfnisse zu äußern und um Unterstützung zu bitten, wenn nötig. Unterstützung kann aber auch bedeuten, bestimmte Themen nicht anzusprechen, wie z.B. sexualisierte Gewalt und/oder körperliche Gewalt. Wenn eine Person über ein Thema nicht sprechen möchte, akzeptieren wir das.
- Vertraulichkeit: Alle Gespräche über persönliche Probleme im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit werden vertraulich behandelt (außer anderes ist explizit so abgesprochen). Wir respektieren die Privatsphäre und die persönlichen Grenzen jedes*jeder Einzelnen.
- Keine Diskriminierung: Diskriminierung oder Stigmatisierung aufgrund von mentalen Erkrankungen tolerieren wir nicht. Wenn wir Diskriminierung mitbekommen, sprechen wir sie aktiv an und schaffen Strukturen, um sie zukünftig zu vermeiden.
- Flexibilität und Unterstützung: Wir bieten flexible Arbeitszeiten und Unterstützung für Kolleg*innen an, die mit mentalen Erkrankungen zu tun haben. Auch in Bezug auf die Arbeitsumgebung ermöglichen wir Flexibilität.
- Selbstfürsorge und Grenzen: Wir ermutigen alle Mitarbeiter*innen, auf ihre mentale Gesundheit zu achten und ihre eigenen Grenzen zu respektieren. Wir weisen uns gegenseitig auf die Wichtigkeit von Pausen und Urlauben hin, wenn uns auffällt, dass wir sie vernachlässigen.
- Eigeninitiative: Bei vielen psychischen Erkrankungen spielt soziale Unterstützung eine große Rolle beim Krankheitsverlauf. Wenn wir wissen, dass Kolleg*innen betroffen sind, informieren wir uns eigenständig darüber, wie Betroffene behandelt werden möchten oder fragen behutsam nach.
- Krisenintervention: Wir haben Mechanismen für die Krisenintervention und bieten Unterstützung für Mitarbeiter*innen an, die sich in einer akuten Krise befinden und Hilfe benötigen.
Warum diese Punkte für Menschen mit PTBS wichtig sind
Respekt und Empathie
Für einige Betroffene kann Smalltalk ein Sinnbild dafür sein, was ihnen abhandengekommen ist: Leichtigkeit. Sie haben, zumindest in einer akuten Phase der PTBS, keinen Zugang zu oberflächlichen Gesprächen, da sie sich dafür stark verstellen und eine Fassade aufrechterhalten müssen.
Ein*e Betroffene*r – wir nennen ihn*sie im Folgenden anonymisiert Marco – erzählt, dass Kolleg*innen oft wenig Verständnis haben, wenn Menschen mit PTBS sich aus Gesprächen zurückziehen, keine Kraft für Interaktion haben, sich wegträumen oder nicht öffnen. Das Gleiche gilt für Konfliktsituationen am Arbeitsplatz, z.B. durch unstimmige Top-Down-Hierarchien oder Dominanzverhalten, auf das Betroffene empfindlicher reagieren können. Marco weiß: Viele Betroffene würden sich weniger Verurteilung wünschen, wenn sie sich nicht immer nahtlos ins Team integrieren wie andere oder sich aus Selbstschutz aus Situationen zurückziehen. Statt eine*n Kolleg*in pauschal zu verurteilen, könnten Nicht-Betroffene sich fragen: Hat sein*ihr Verhalten gerade wirklich etwas mit mir zu tun?
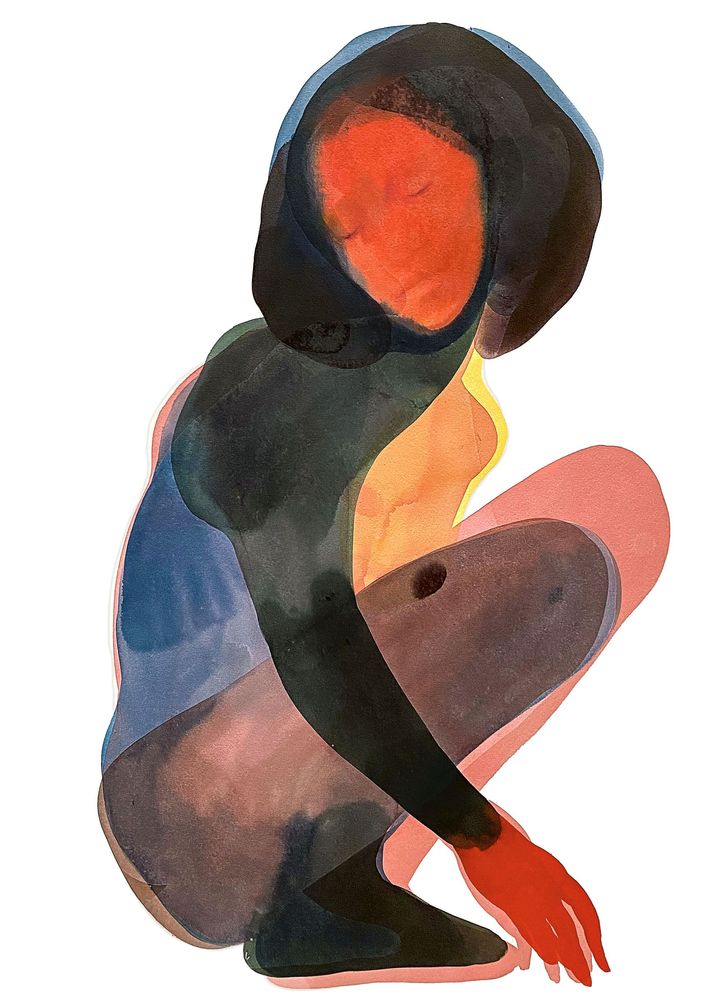
Keine Diskriminierung
Wenn Menschen von ihren psychischen Erkrankungen berichten, sehen sie sich oft mit dem Vorurteil konfrontiert, dass sie aufgrund der Erkrankung weniger leistungsfähig seien. Das trifft aber nicht auf jede psychische Erkrankung zu: Eine Person mit einer hochfunktionalen Depression kann trotz depressiver Episode ggf. sehr leistungsfähig sein. Außerdem verlaufen die meisten Erkrankungen phasenweise. Gleichzeitig wird von Betroffenen, deren Leistungsfähigkeit tatsächlich phasenweise eingeschränkt ist, oft erwartet, dass sie jederzeit ein normales Pensum schaffen. Beides kann dazu führen, dass Betroffene am Arbeitsplatz benachteiligt werden.
Statt Menschen mit psychischen Erkrankungen zu stigmatisieren und ihre Erlebnisse zu generalisieren, sollten wir individuelle Rahmenbedingungen schaffen, die eine gute Arbeitsumgebung ermöglichen. Marco erzählt z.B., dass Betroffene Kritik zu einem Teil ihrer Arbeit schnell auf ihre ganze Arbeit übertragen können. Das sei das Trauma-Denken, das auf negativen Grundannahmen über die Person selbst basiert. Betroffenen würde es helfen, möglichst konkretes, sachliches Feedback ohne Zwischentöne zu bekommen: Was genau hat meinem Gegenüber nicht gefallen und warum? Was genau wünscht sich das Gegenüber anders?
Flexibilität und Unterstützung
Für Menschen mit psychischen Krankheiten kann die Möglichkeit zum Homeoffice eine enorme Entlastung sein. Für Betroffene von PTBS gilt dies besonders, da sie oft auch von Schlafstörungen betroffen sind und durch das Arbeiten zu Hause den Arbeitstag flexibel an den eigenen Rhythmus anpassen können. Wenn die Möglichkeit zum Homeoffice nicht gegeben ist, können Rückzugsmöglichkeiten im Büro hilfreich sein.
Dabei gehe es weniger um ein akutes Rückzugsbedürfnis, wenn es Betroffenen plötzlich schlecht geht, sondern ein besseres Verständnis dafür, dass eine chronische PTBS eine schwere Erkrankung und Rückzug deshalb ein ständiges Thema ist, beschreibt Marco. Seiner*Ihrer Meinung nach würde es Betroffenen helfen, situativ entscheiden zu können, ob sie das Team sehen und treffen möchten, wenn ihre Symptome es ihnen ermöglichen.
Ein Schritt hin zu mehr Verletzlichkeit
Organisationen können die individuellen Traumatisierungen ihrer Mitarbeiter*innen natürlich nicht heilen. Aber sie sollten Rahmenbedingungen schaffen, die eine Traumatisierung zumindest nicht verschlechtern, insbesondere, weil soziale Unterstützung für den Krankheitsverlauf von Betroffenen sehr wichtig ist. In vielen Berufsgruppen galt lange der Glaubenssatz: „Das musst du als Ärzt*in/Soldat*in etc. eben abkönnen.“
Solche Glaubenssätze werden – zum Glück – heutzutage immer stärker hinterfragt. Darf es eine Ärztin wirklich nicht mitnehmen, wenn sie ein Kind nicht wiederbeleben konnte? Zudem „wächst in Unternehmen die Bereitschaft, Unterstützungsangebote zu ermöglichen, auch außerhalb von rechtlichen Verpflichtungen“, sagt die Psychologin Benthe Untiedt. „Ich glaube, das hängt mit der Frage zusammen, was in einer menschenzentrierten Arbeitswelt eigentlich wichtig ist. Wenn wir unter Neuer Arbeit mehr verstehen als Scrum und produktivere Meetings, dann können Menschen sich tatsächlich verletzlich machen, soziale Unterstützung bei der Arbeit erleben und die Normalisierung von psychischen Krankheiten.“

Input-Geberin
Benthe Untiedt ist Psychologin und Beraterin bei SHITSHOW – Agentur für Psychische Gesundheit. Sie findet es wichtig, dass Menschen, die traumatische Situationen erleben, nicht alleine mit den Folgen leben müssen, sondern privat und professionell Unterstützung erhalten.
Zum Weiterlesen
- Trauma ist ziemlich strange von Steve Haines (Comic)
- Sexueller Missbrauch in Familie und Institutionen von Mechthild Gründer und Magdalena Stemmer-Lück
- Vom Mythos des Normalen von Dr. Gabor Maté mit Daniel Maté
- Healing Trauma: A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body von Peter A. Levine
- Das Trauma in dir von Bessel van der Kolk
FUßNOTEN
- 1
Sabine Schuchart: Berühmte Entdecker von Krankheiten: Hermann Oppenheim, ein tragischer Visionär (2020) ↩
- 2
Dagmar Arndt & Irmtraud Beerlage: Psychische Belastung und Belastungsfolgen in der Akut-, Intensiv- und Notfallmedizin (2019) ↩
- 3
DGPPN: Psychische Traumata oft unbehandelt (2015) ↩
- 4
Portal der Bundesregierung zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ↩