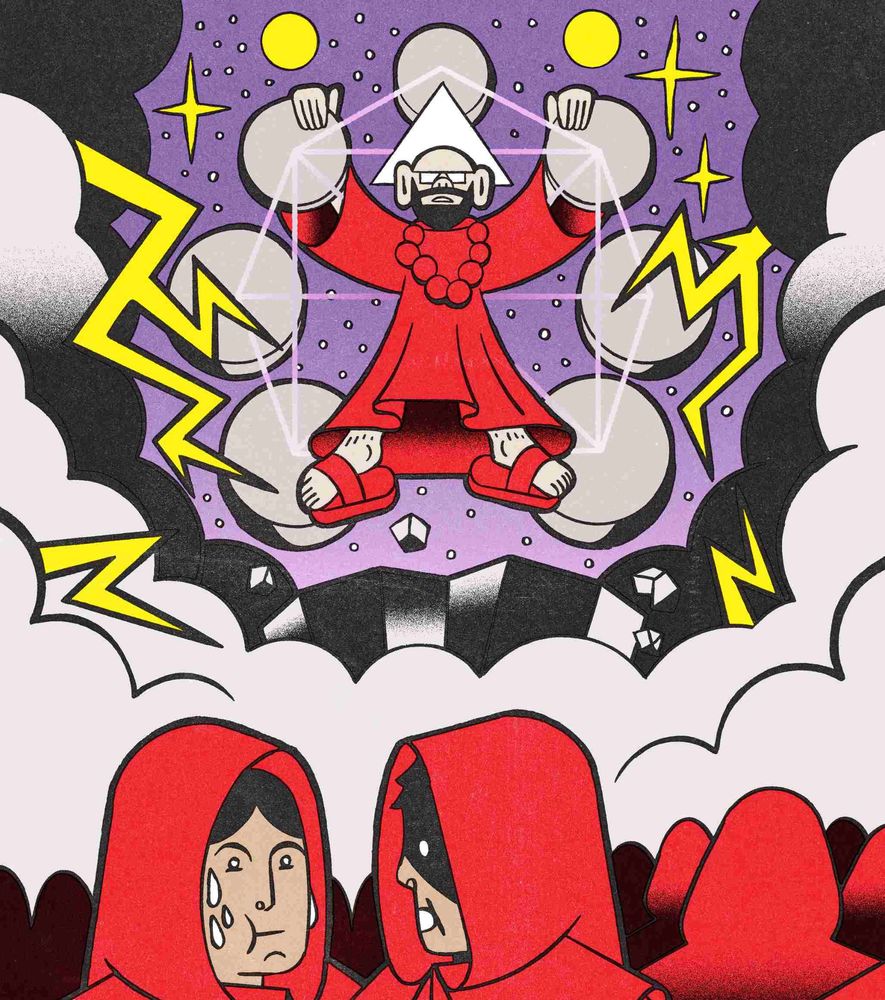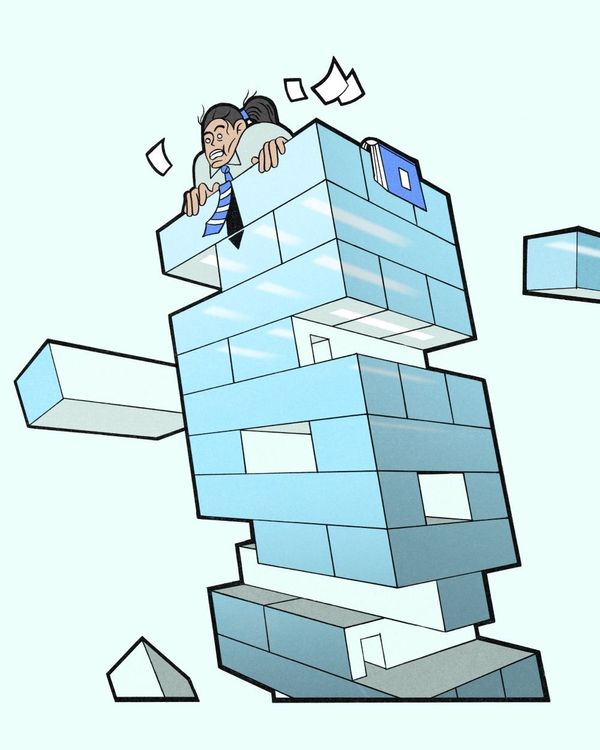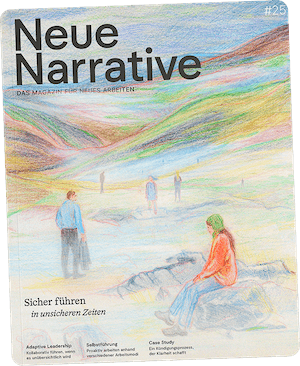Kompetenz im Umgang mit Emotionen ist ein wichtiger Bestandteil einer zukunftsfähigen Arbeitswelt. Egal ob es die eigenen oder die der anderen sind. Trotzdem haben sie immer noch nicht in allen Organisationen Raum. Deshalb gibt es diese Kolumne. Dieses Mal geht es um das gute Gefühl, auf vermeintlich wichtige Networking-Events zu verzichten.
Wann immer ich mich auf Meet-ups oder andere Networking-Veranstaltungen verirre, scanne ich den Raum zu allererst nach dem Ort für Getränke ab. Ich bin die, die in einer Ecke steht und auf ihrem Handy scrollt, damit niemand auf die Idee kommt, mich anzusprechen. Ich mag Menschen. Ich würde sogar sagen: Ich bin gut darin, stabile Beziehungen aufzubauen. Aber ich hasse Smalltalk und Networking-Events sind das El Dorado für Smalltalk.
Networking dient dazu, den Aufbau beruflicher Beziehungen zu unterstützen. So soll ein Bekanntenkreis entstehen, der für mich potenziell nützlich ist. Aber im Gegensatz zur allgemeinen Empfehlung, sich ein möglichst großes Netzwerk aufzubauen, verpasse ich Networking-Events mittlerweile gern und baue stattdessen lieber richtig gute Beziehungen. Richtig gut ist eine Beziehung für mich, wenn mein Gegenüber und ich merken, dass wir uns respektieren, uns für die Gedanken des anderen wirklich interessieren und uns offen und ehrlich begegnen können. Ganz ohne Business-Maskerade, Visitenkartenübergabe und Ego-Pitch.

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative
Magazin kostenlos lesenWarum es mir lange schwerfiel, nicht dabei zu sein
Natürlich fällt es mir nicht immer leicht, Networking-Veranstaltungen fernzubleiben. Ständig werden Events beworben und Einladungen zu Meetings flattern in meine Inbox, an denen andere wichtige Menschen bereits teilnehmen. Wenn die dabei sind, muss ich auch dabei sein, oder?
Fear of missing out, kurz FOMO, wird das Gefühl genannt, etwas Wichtiges zu verpassen. Wer unter FOMO leidet, versucht deshalb, bei möglichst vielen Events und Meetings dabei zu sein. In Sozialen Netzwerken werde ich täglich mit einem Klick zu vielen solcher Events eingeladen. Und so bin ich vor 9 Uhr bei einer informellen Lerngruppe rund um New Work dabei, nehme mittags an einem digitalen Working Lunch mit einer sagenumwobenen Gründerin teil und am Abend bin ich bei einem Online-Event zu meinem Herzensthema mit tollen Speaker*innen dabei. Aber was passiert, wenn ich bei einem ultrawichtigen Zoom-Event den besten Talk verpasse und dafür offline barfuß durchs Gras laufe? Nichts. Mal davon abgesehen, dass es meistens einen Video-Mitschnitt gibt.

Das gute Gefühl, etwas zu verpassen
Neulich schrieb mir jemand auf LinkedIn, dass wir uns jetzt, wo ich seine Kontaktanfrage angenommen habe, doch auf jeden Fall zu einem virtuellen Kaffee verabreden sollten. Wozu sei die Kontaktbestätigung sonst gut gewesen? Ich fragte, zu welchem Thema er denn gern mit mir sprechen möchte, damit ich entscheiden kann, ob dieses Thema gerade zu meinen Prioritäten passt. Und ich rechne: Wenn ich mit jedem Kontakt meines LinkedIn-Netzwerks Kaffee trinken würde, dann hätte ich keinen Job mehr. Er meldet sich nie wieder. War wohl doch nicht so wichtig.
Joy of missing out, kurz JOMO, ist das Gegenteil von FOMO. Es beschreibt das gute Gefühl, etwas zu verpassen. Es ist vergleichbar mit spontanem Hitzefrei oder geschwänzten Schulstunden. Heute schwänze ich statt der Schule Networking-Events und verbringe die Zeit mit Menschen, die mich wirklich interessieren. Nicht mit welchen, hinter denen ich eine taktisch kluge Karriereoption vermute. Viel mehr Wert als auf ein riesiges Netzwerk aus Fremden lege ich auf Beziehungen mit wenigen guten Bekannten aus meinem beruflichen Umfeld. Statt anderen wahllos Kaffeedates anzubieten, sorge ich für mich und versuche immer wieder neu herauszufinden, was und wer mich wirklich interessiert. Diese Beziehungen bleiben ein beständiger, wertvoller Teil meines Lebens.
Wie ich mich selbst im Blick behalte
Immer häufiger entscheide ich mich deshalb dazu, Networking-Events abzusagen. Meistens spüre ich danach Erleichterung: Ich habe mir Zeit verschafft. Was mir dabei hilft, ist Klarheit darüber, was mir gut tut, und die Fähigkeit, im Alltag herauszuzoomen, um mit genügend Abstand auf mich selbst und meine Entscheidungen zu schauen.
Dafür habe ich mir eine Tagtraum-Routine angewöhnt: Ich reise in meiner Vorstellung auf meinen inneren Planeten, setze mich ans Feuer und betrachte mich von Oben. Mit viel Abstand und ohne Ablenkung kann ich mich und meine Bedürfnisse wie eine Forscherin beobachten und viel leichter erkennen, ob ich mich gerade von außen steuern lasse oder ob ich selbst steuere. Und mich dann bewusst entscheiden.
Genau darin liegt für mich der Kern: Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, dann kenne ich all meine Macken und Stärken gut und weiß für welche Themen ich mich leidenschaftlich einsetzen möchte und welche Situationen keinen Mehrwert für mich haben. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun, von der viele behaupten, dass man sie bräuchte, um gute Beziehungen mit anderen eingehen zu können. Das ist völliger Quatsch. Ich finde einiges überhaupt nicht cool an mir und trotzdem habe ich sehr stabile Beziehungen zu anderen. Der Unterschied ist schlichtes Selbstbewusstsein. Ich weiß, was mir schwerfällt, und ich weiß, was mir Energie gibt: tiefe intensive Gespräche und gemeinsames Denken zu den Themen, die mich brennend interessieren. Beziehungsqualität entsteht für mich durch Resonanz mit anderen. Nicht durch ein zweckdienliches Netzwerk.
Gute Beziehungen entstehen durch Resonanz, nicht durch ein zweckdienliches Netzwerk.