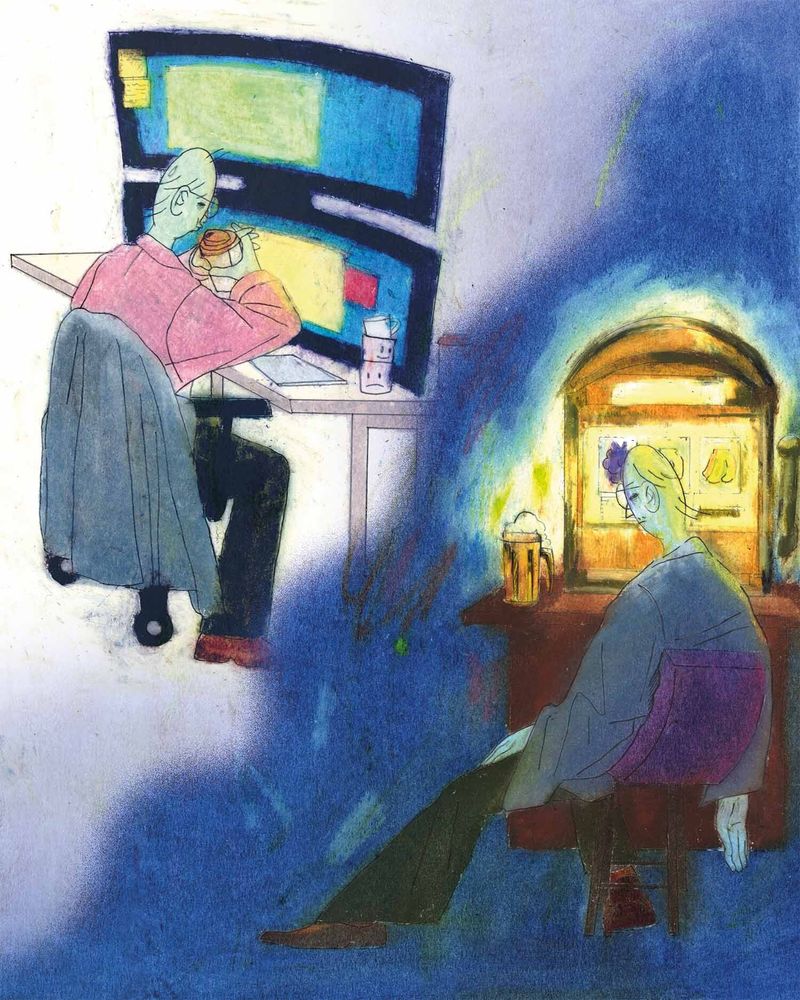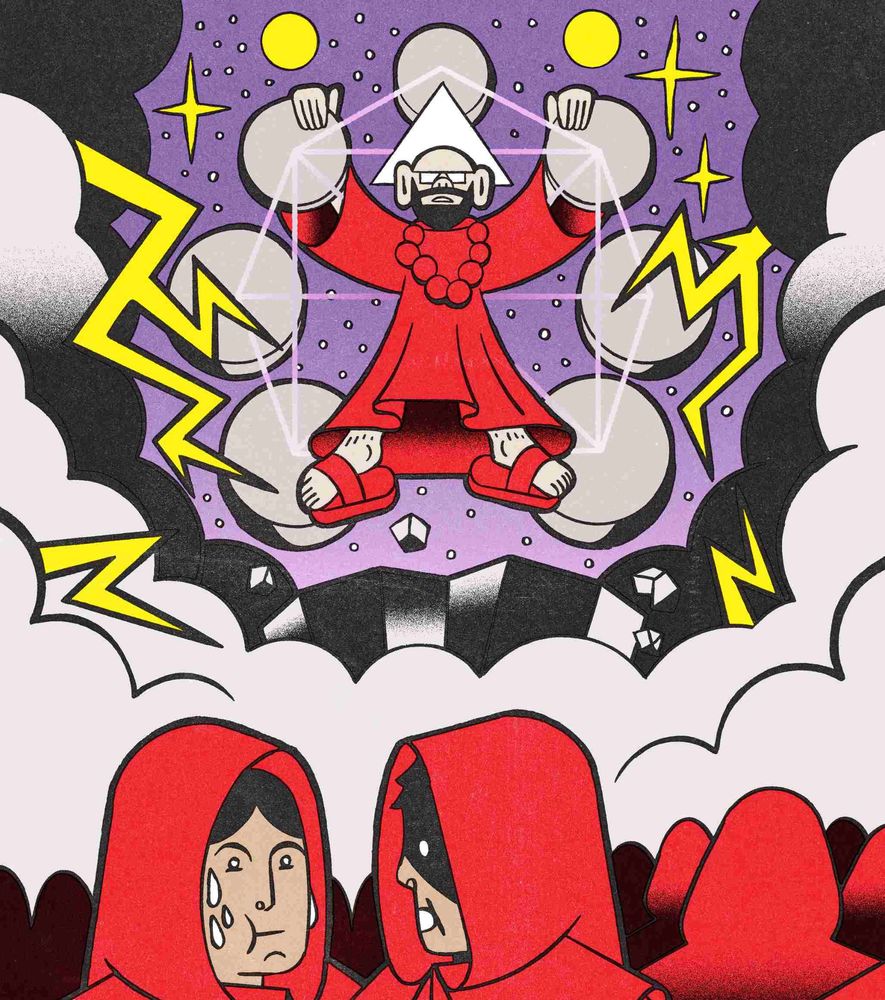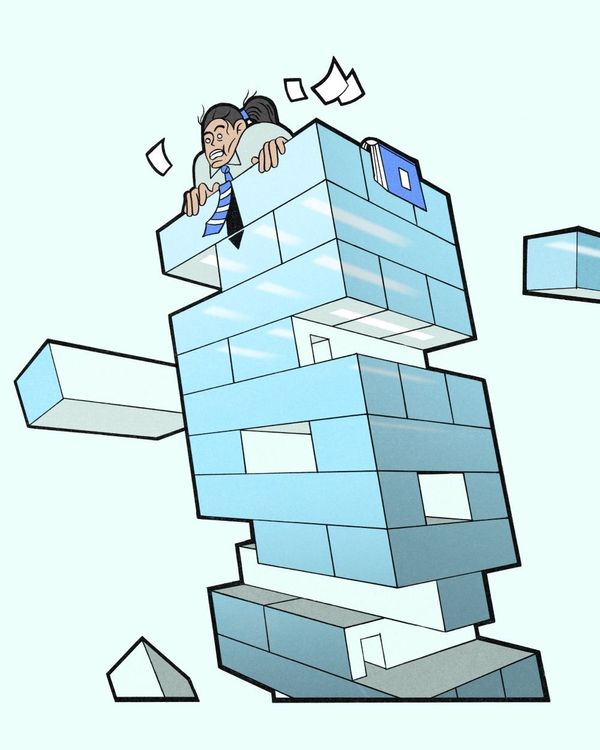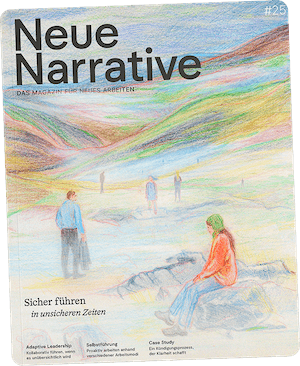Mehr als jede*r achte Deutsche ist von einer Suchterkrankung betroffen. Wenn Arbeitgeber ihre Angestellten schützen wollen, müssen sie bei der Prävention unterstützen und einen Ablaufplan für Fälle von Suchterkrankungen am Arbeitsplatz entwickeln.

Sicher führen: unsere neue Ausgabe ist da!
Abo sichernUnsere Welt wird politisch, ökologisch und wirtschaftlich immer instabiler – das ist für uns alle mental belastend. Im Zusammenspiel mit unserer Hustle-Kultur und dem steigenden Arbeitsdruck schafft das den Nährboden für psychische Erkrankungen – die Fallzahlen steigen.1 Dort können auch Süchte gedeihen. Abhängigkeit ist kein Randproblem der Gesellschaft. 2018 waren 13,5 Prozent der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland von mindestens einer der folgenden Substanzen abhängig: Alkohol2, Tabak, Cannabis, Amphetamine, Kokain, Schmerzmittel, Schlaf- und Beruhigungsmittel. Dazu kommen verhaltensbezogene Süchte wie Spielsucht oder Internetsucht.
Obwohl Abhängigkeit so viele betrifft, ist sie gerade im Arbeitskontext ein besonders großes Mental-Health-Tabu, sagt Benthe Untiedt von Shitshow, Agentur für psychische Gesundheit. Manche Süchte werden normalisiert oder weniger ernst genommen als andere: Wer sich jeden zweiten Abend mit einem Feierabenddrink belohnt, geht noch als Genießer*in durch. Und wer nach einem Burn-out Schlaftabletten zum Einschlafen braucht, hat sich für die Firma sogar kaputt gearbeitet. Anders sieht es aus, wenn sich herumspricht, dass der Kollege aus der Buchhaltung jede Nacht am Spielautomaten verbringt oder Amphetamine konsumiert. Bestimmte Suchterkrankungen werden in der Gesellschaft mit sozial benachteiligten Menschen assoziiert und lösen im Umfeld oft Ekel und Ablehnung aus. Das zeigt sich auch in sprachlichen Wendungen wie „auf etwas hängenbleiben“, mit denen Suchtkranke stigmatisiert werden. Süchte werden anders bewertet als andere psychische Erkrankungen, denn sie werden als eigene Entscheidung interpretiert. Häufig aber liegt es an gesellschaftlichen Strukturen, dass Menschen in die Sucht geraten – und dort wieder herauszufinden, ist umso schwieriger, je mehr Vorurteile ihnen entgegengebracht werden.
Stigmata und Tabus sorgen auch dafür, dass Mitarbeitende nicht genug über Hilfsangebote aufgeklärt werden. Ein guter Umgang mit dem Thema Sucht am Arbeitsplatz besteht aus drei Dingen: der Enttabuisierung, einer guten Präventionsstrategie und einem soliden Plan, wie das Team mit vorhandenen Fällen umgeht.
Süchte werden anders bewertet als andere psychische Erkrankungen, denn sie werden als eigene Entscheidung interpretiert. Häufig aber liegt es an gesellschaftlichen Strukturen, dass Menschen in die Sucht geraten.
Was ist Sucht und wie entsteht sie?
Eine Suchterkrankung ist eine psychische Erkrankung. Es wird unterschieden zwischen stoffgebundenen Süchten – z.B. Alkohol, Nikotin, Medikamente – und stoffungebundenen Süchten – z.B. Glücksspiel, Pornografie, Soziale Medien. Neurobiologisch gesehen ähneln sich alle Süchte, da sie eine Störung unseres Belohnungszentrums darstellen. Bei stoffgebundenen Süchten docken die Substanzen an Rezeptoren der Botenstoffe in unserem Gehirn an und beeinflussen Neurotransmitter wie Dopamin oder Serotonin. Bei stoffungebundenen Süchten verknüpft das Gehirn bestimmte Reize (z.B. den Anblick einer Glücksspiel-App) mit der Erwartung einer Belohnung. Dadurch wird das Belohnungssystem künstlich überflutet und kann sich nicht mehr selbst ohne den Reiz oder die Substanz regulieren.
Nach ICD‑11 der Weltgesundheitsorganisation liegt eine Abhängigkeit vor, wenn zwei oder mehr der folgenden Faktoren zutreffen:
- ein starkes, meist unbezwingbares Verlangen nach der Substanz
- Verlust der Kontrolle über Beginn, Ende oder Menge des Konsums
- Toleranzentwicklung: Man braucht immer mehr, um dieselbe Wirkung zu spüren.
- Entzugserscheinungen beim Absetzen
- ein fortgesetzter Gebrauch trotz schädlicher Folgen
Die Diagnose stellen Ärzt*innen oder andere qualifizierte Fachkräfte. Je nach Suchtmittel können Betroffene die Abhängigkeit nur mithilfe einer überwachten Entzugstherapie in den Griff kriegen und müssen ihr Leben lang diszipliniert sein, um nicht rückfällig zu werden.
Alle Menschen können abhängig werden, aber manche sind suchtgefährdeter als andere. Ein Erklärungsansatz für die Entstehung von Süchten ist das biopsychosoziale Modell: Es geht davon aus, dass sowohl genetische als auch psychische Faktoren – wie ein geringes Selbstwertgefühl oder Traumata und soziale Einflüsse – eine Abhängigkeit begünstigen. Ebenfalls fallen Süchte häufig mit anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen zusammen. Einige Suchtmittel dienen als Coping-Mechanismus, also als Versuch, mit einer psychischen Belastung umzugehen – besonders dann, wenn andere Unterstützung fehlt.
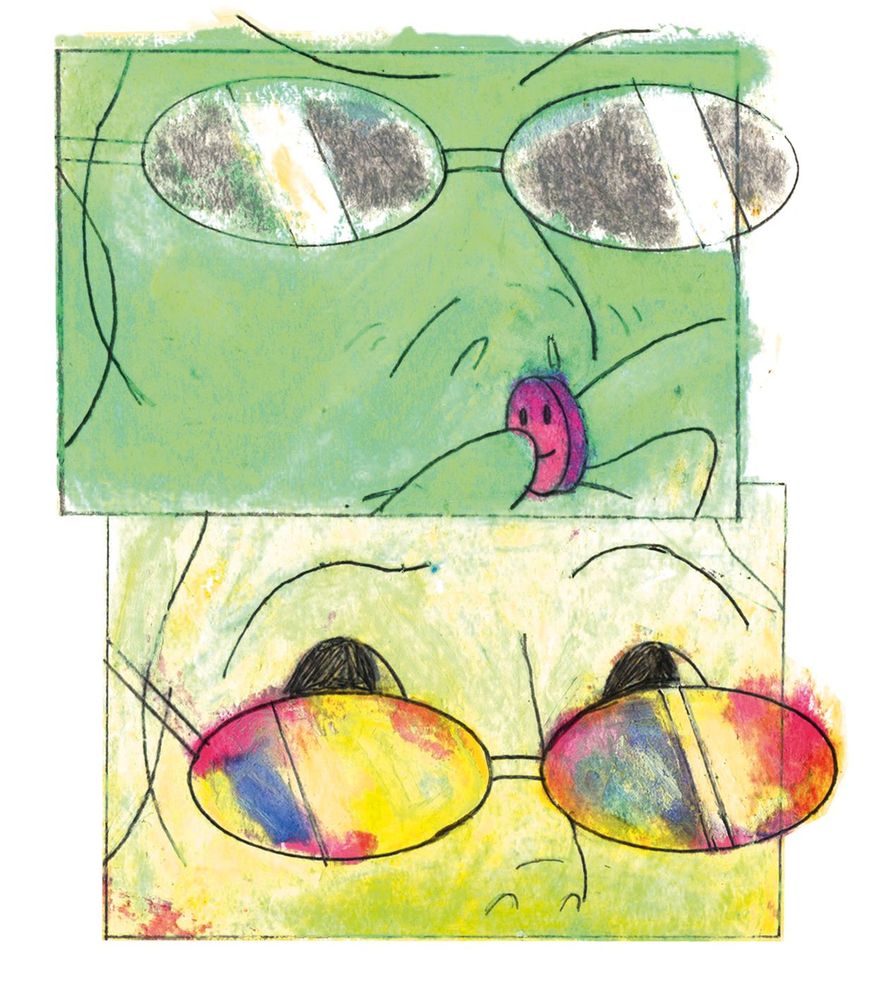
Untiedt sagt, dass Sucht häufig als eine Form der Selbstmedikation oder Emotionsregulation beginne, etwa bei Einschlafproblemen oder zur Auflockerung bei sozialen Unsicherheiten: „Man kann fast jede Substanz _ge_brauchen, aber die Schwelle zum Missbrauch ist nicht hoch.“ Neben gesellschaftlichen Faktoren können private Krisen wie ein Todesfall oder eine Trennung Menschen zusätzlich aus der Balance bringen. Doch auch am Arbeitsplatz begünstigen verschiedene Umstände die Entwicklung einer Sucht.
Suchtbegünstigende Faktoren am Arbeitsplatz
In unserer leistungs- und erfolgsorientierten Gesellschaft müssen wir Stress und starke Emotionen regulieren und dem Erwartungsdruck von uns selbst und anderen standhalten. Dazu kommen Arbeitsverdichtung, Change-Prozesse z.B. im Zuge der Digitalisierung, Versagensängste und mangelnde Wertschätzung von Vorgesetzten oder Kolleg*innen. Sowohl Über- als auch Unterforderung oder Langeweile können Sucht begünstigen, sagt Suchttherapeut Niels Pruin, der das Fachgebiet Medien- und Internetsucht des Caritasverbandes der Diözese Augsburg leitet. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommen noch Faktoren wie Ressourcenknappheit und Jobunsicherheit dazu, je nachdem, wie sehr das Unternehmen davon betroffen ist.
Das Suchtmittel hilft dabei, Stress zu ertragen oder unsere Leistung und Konzentration zu steigern. Gerade Führungskräfte, die viel Verantwortung tragen und selten Unterstützung bekommen, neigen dazu, Substanzen zu nehmen, die aufputschen und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Auch die Überlastung in Branchen mit langen Arbeitszeiten und Nachtschichten führt zum Konsum von Medikamenten zum „Funktionieren“.
„Man kann fast jede Substanz gebrauchen, aber die Schwelle zum Missbrauch ist nicht hoch.“
Benthe Untiedt
Sucht am Arbeitsplatz
In unserer Arbeitswelt macht sich Abhängigkeit meist erst bemerkbar, wenn sie zu Leistungsausfällen führt. Es gibt Branchen, in denen bestimmtes Suchtverhalten sogar als „funktional“ angesehen wird, z.B. Koffeinsucht bei Notfallpersonal oder Workaholism in der Finanzwelt.3 Auch regelmäßiger Alkoholkonsum gehört in vielen Firmen zur Kultur. Aber irgendwann kippt es, wenn der*die Mitarbeiter*in nicht mehr ihre gewohnte Leistung bringen kann oder sich oder andere gefährdet.
Tablettenmissbrauch spielt ebenfalls am Arbeitsplatz eine Rolle. Das konzentrationsfördernde ADHS-Medikament Ritalin nutzen Menschen ohne ADHS in Hochleistungsumgebungen als Geheimtipp. Laut manager magazin gehören auch Beruhigungsmittel wie Diazepam bei Manager*innen zu den Topsellern unter den verschreibungspflichtigen Psychopharmaka.4 Sie dämpfen die Aufregung, machen aber bei regelmäßiger Einnahme süchtig. Härtere Drogen sind zwar nicht so alltäglich in der Arbeitswelt, aber Kokain etwa gilt als „Droge der Alphatiere“ und Highperformer*innen.
In der letzten Zeit wird auch Internet- und Social-Media-Sucht am Arbeitsplatz relevant. Allerdings ist noch unbekannt, wie sich die Süchte langfristig auf Menschen auswirken werden. Daher sind sie schwierig zu regulieren, werden aber durch ihr hohes Sucht- und Ablenkungspotenzial laut Pruin zum ernsten Thema in den Organisationen und der Gesellschaft.
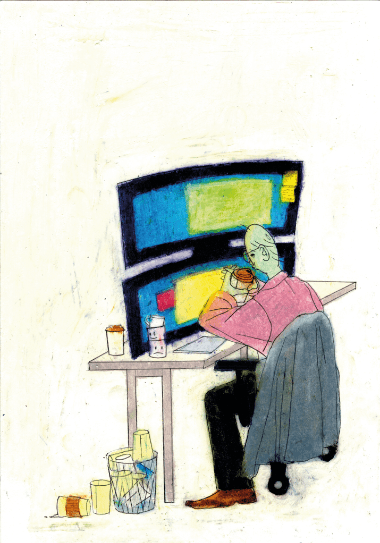
Eine Präventionsstrategie bauen
Rechtliche Vorgaben dazu, wie Unternehmen mit Sucht am Arbeitsplatz umgehen sollen, gibt es nicht. Arbeitgeber müssen also selbst ein innerbetriebliches Regelwerk zur Suchtprävention aufstellen. Das beinhaltet meist Ge- oder Verbote im Umgang mit bestimmten Suchtmitteln. Besonders Betriebe mit hohem Sicherheitsrisiko, etwa im Bauwesen, in der Gesundheits- oder Transportbranche, schreiben eine Null-Alkohol- und inzwischen auch Null-Cannabis-Toleranz in ihrer Betriebsvereinbarung fest.
Große Unternehmen wie VW oder Bosch und öffentliche Einrichtungen wie Universitäten haben zudem eine innerbetriebliche Suchtberatungsstelle. Einige Organisationen holen sich auch Hilfe von externen Suchtberater*innen, die bei einer auf den jeweiligen Betrieb angepassten Betriebsvereinbarung helfen: „Gerade neue oder junge Führungskräfte wissen oft gar nicht, was sie alles vorschreiben dürfen“, sagt Pruin.
So hilfreich betriebliche Vorschriften sind, um den Umgang mit Substanzen oder Verhalten zu regeln – es sind noch andere Maßnahmen wichtig: erstens, suchtbegünstigenden Faktoren in der Organisation vorzubeugen, und zweitens Hilfsangebote für Betroffene zu schaffen.5
Suchtprävention
Zur Prävention gehört im ersten Schritt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um psychischen Belastungen und Suchtrisiken am Arbeitsplatz vorzubeugen: Wird darauf geachtet, dass Mitarbeitende ihre Pausen nehmen und abschalten (können)? Haben sie ständigen Performance- oder Fristendruck? Generell zuträglich für alle Themen rund um mentale Gesundheit ist, die Arbeitslast einzugrenzen und für ein gutes Betriebsklima, Kooperation und Zusammengehörigkeitsgefühl zu sorgen. Was auch dazu gehört, sind Unterstützung bei privaten Krisen und z.B. Hilfe für Menschen mit Care-Verantwortung. Für Untiedt sind neben den Arbeitsbedingungen die psychologische Sicherheit im Team und Beziehungsarbeit besonders wichtige Faktoren. Dass Mitarbeitende jemandem sagen können: „Ich bin belastet“, spielt eine große Rolle bei der Prävention psychischer Erkrankungen. Strukturell kann das z.B. durch Mental health first aider unterstützt werden, also Kolleg*innen, die bei psychischen Problemen erste Hilfe leisten können.6

Aufklären und Sensibilisieren
Das Problem beim Thema Abhängigkeit ist nicht die Wissenslücke, dass Suchtmittel gesundheitsschädlich sind. Das ist den meisten klar. Weniger klar ist, ab wann der Konsum risikobehaftet ist, unter welchen Umständen Sucht entsteht und dass sie jede*n treffen kann. Viele denken: „Das Thema betrifft mich nicht“, sind aber vielleicht längst in der Grauzone oder haben eine biologische Affinität, abhängig zu werden. Darüber können Organisationen in Vorträgen aufklären. Außerdem ist es sehr wirksam, Betroffene sprechen zu lassen, da wir über deren Geschichten lernen können, wie es wirklich ist, suchtkrank zu sein. Je mehr wir zeigen, dass es ganz gewöhnliche Menschen betrifft, desto mehr holen wir das Thema aus der vermeintlich „asozialen“ Ecke.
Es sollte aber nicht nur aufgeklärt, sondern auch sensibilisiert werden. Zum Beispiel, indem wir Suchtmittel schwieriger zugänglich machen und entnormalisieren. Muss es zwingend den Prosecco-Freitag oder Firmenevents geben, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird? Achtsamer mit derartigen Genussmitteln zu sein, hilft auch trockenen Alkoholiker*innen durchzuhalten, und sie müssen nicht immer erklären, warum sie nicht trinken.

Umgang mit vorhandenen Suchterkrankungen
Selbst die ausgeklügelteste Suchtpräventionsstrategie schützt Unternehmen nicht davor, dass es irgendwann Fälle von Abhängigkeiten geben kann. Je schneller Betroffene Hilfe bekommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung besiegt wird. „Verschweigen hilft Süchten“, so Untiedt. Doch woher weiß ich, dass ich handeln muss, und wie spreche ich es an?
Niels Pruin sagt: „Wirklich zu erkennen, dass Kolleg*innen betroffen sind, ist nur für diejenigen möglich, die die Person regelmäßig sehen und sie wirklich kennen.“ Frühwarnzeichen sind bei fortgeschrittenen substanzbezogenen Abhängigkeiten etwa, wenn der*die Kolleg*in Probleme mit der Feinmotorik zeigt, schwitzt oder zittert. Schwieriger sind Symptome zu erkennen, wenn die Abhängigkeit keinen sichtbaren körperlichen Einfluss auf die Person hat. Bei sogenannten hochfunktional Süchtigen ist es sogar unmöglich, von außen zu sehen, wie gefährdet sie sind, weil sie ihre Sucht besonders gut verstecken können. Es gibt aber kleine Hinweise. Pruin zufolge sei es auffällig, wenn sich das Verhalten des*der Kolleg*in stark verändert, er*sie sich zurückzieht, häufiger fehlt, desinteressiert wirkt oder einen deutlichen Leistungsabfall zeigt.
Führungskräfte und Kolleg*innen schulen
Führungskräfte mit Personalverantwortung nehmen eine Schlüsselrolle beim Umgang mit Suchterkrankungen am Arbeitsplatz ein. Ein gutes Suchthilfeprogramm schult Vorgesetzte darin, wie sie heikle Fälle frühzeitig erkennen und wie sie ein Gespräch darüber führen. Bei Shitshow gibt es Leader-Ally-Trainings, bei denen Sucht auch ein Teilaspekt ist. Es gibt in vielen Organisationen ohnehin Leadership-Trainings, dort lässt sich das Thema „psychische Erkrankungen und Sucht“ eingliedern. Doch nicht nur Führungskräfte sollten sich auskennen. Erstens könnten sie selbst betroffen sein, und zweitens verhindert das Machtverhältnis häufig, dass Mitarbeiter*innen mit Suchterkrankung sich ihrem*ihrer Chef*in anvertrauen. Eine interne Person mit der Rolle Suchtberater*in kann ggf. an externe Beratungsstellen und Therapiestellen vermitteln.
Je schneller Betroffene Hilfe bekommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung besiegt wird. „Verschweigen hilft Süchten“.
Benthe Untiedt
Fürsorgegespräch
Desinteresse und Leistungsabfall müssen nicht eindeutig auf eine Suchtproblematik hindeuten, sondern sind zunächst Marker dafür, dass eine Person psychisch belastet ist. Führungskräfte sollten sich aber nicht davor drücken, die Auffälligkeit in einem ersten Fürsorgegespräch anzusprechen, auch wenn es unangenehm ist. Katja Beck-Doßler, Leiterin der betrieblichen Sucht- und Konfliktberatungsstelle der Universität Würzburg, sagt: „Man kann nichts falsch machen, außer man tut nichts.“ Pruin rät darüber hinaus dazu, subjektive und detaillierte Wahrnehmungen mit der Person zu teilen. „Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit häufig zu spät kommst und viele Fehler machst. Belastet dich etwas?“ Vermieden werden sollten hingegen konfrontative Diagnosen wie: „Ich glaube, du bist alkoholkrank.“ Ansprechen müssen wir es aber, denn: „Der Arbeitgeber hat Fürsorgepflicht“, sagt Pruin. „Ich hab keine Zeit“ oder „Das ist Privatsache“ sind keine Argumente. Pruin kennt viele aus der Suchtberatung, die froh gewesen wären, wenn sie jemand angesprochen hätte.
Wenn Kolleg*innen sich nicht trauen, so ein Gespräch zu führen oder die betroffene Person decken, also etwa ihr eigenes Arbeitspensum erhöhen oder Notlügen erfinden, ist das verständlich, aber oft kontraproduktiv. „So hart es klingt“, sagt Pruin, „ein größerer Leidensdruck erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute in die Beratungsstelle kommen, wo ihnen wirklich geholfen werden kann.“ Betroffene holen sich selten ohne Druck von außen die nötige therapeutische Hilfe. Beck-Doßler erklärt, dass bei den meisten eine innere Ambivalenz besteht: Ein Teil erkennt das Problem, der andere Teil leugnet es aber. Wenn wir den Teil, der etwas ändern will, überzeugen, kann das Leben retten.
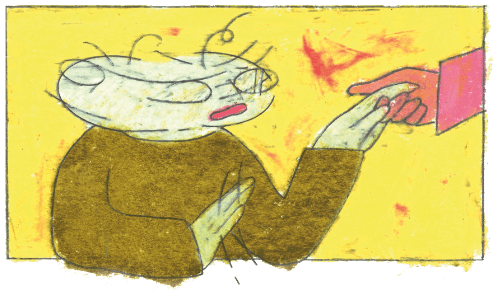
Stufengespräche
Wenn nach dem ersten Gespräch keine Verhaltensänderungen oder Bemühungen erkennbar sind, beginnen in der Regel die sogenannten Stufengespräche (auch Stufenplanverfahren oder betriebliches Interventionsverfahren genannt). Sie folgen einem festen Ablaufplan. Forscher*innen in den USA entwickelten den Stufenplan in den 1940er-Jahren, in der BRD führten Betriebe ihn in den 1970er-Jahren ein. Das Ziel der Stufengespräche ist, suchtkranke Mitarbeiter*innen vor der Kündigung zu bewahren und gleichzeitig die Interessen der Arbeitgeber zu wahren. In der Regel gibt es fünf Stufen:
- Stufe 1: Fürsorgegespräch
Vertrauliches Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter*in: Führungskraft weist auf Auffälligkeiten hin und zeigt interne und externe Hilfsangebote auf, empfiehlt ggf. Therapie. Es werden keine Sanktionen angesprochen, aber ein zweites Gespräch zeitnah vereinbart. - Stufe 2: Klärungsgespräch
Neben den Hilfsangeboten werden nun auch die Erwartungen benannt: „Ich erwarte, dass du die nächsten zwei Wochen pünktlich zur Arbeit erscheinst und dass du ein Hilfsangebot wahrnimmst, damit es besser wird.“ - Stufe 3 und 4: Vertiefungsgespräche
Das Ziel mehrerer folgender Gespräche ist, den Betroffenen die ernste Lage vorzuführen und zu signalisieren: „Es ist nicht okay, was passiert. Wir als Betrieb müssen handeln, und wir geben dir die Chance, zu handeln und ein Hilfsangebot wahrzunehmen.“ Wenn die Person nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern, kann abgemahnt und angekündigt werden, dass es zur Kündigung kommen kann. Zu diesem Zeitpunkt sind auch Suchtberater*innen und ein Mitglied aus der Personalabteilung dabei. Eine Therapie dürfen Arbeitgeber übrigens nicht erzwingen, die Entscheidung liegt bei den Betroffenen. Wenn diese eine andere Strategie finden, ihre Arbeitsleistung trotz Sucht wiederzuerlangen, können Arbeitgeber nicht deshalb abmahnen. - Stufe 5: Einleitung des Kündigungs- oder Disziplinarverfahrens
Je nach Lesart ist dies die allerletzte Chance. Wenn keine Besserung in Sicht ist und Hilfe abgelehnt wird, leitet die Personalabteilung das Kündigungsverfahren ein. Diese Stufe kommt aber äußerst selten vor.
Nachsorge
Etwa die Hälfte aller Betroffenen wird innerhalb des ersten Jahres rückfällig, doch Beck-Doßlers Erfahrung nach sinkt die Rückfallquote deutlich, wenn eine innerbetriebliche Nachsorge vorhanden ist. Sie begleitet die Betroffenen, hält Kontakt und fragt nach, wie es läuft – auch in Gesprächsgruppen. Zusätzlich werden die Mitarbeitenden ein halbes Jahr betriebsärztlich betreut, um die Suchtmittelfreiheit zu sichern. Viele empfinden dieses Korsett als hilfreich.
Am Universitätsklinikum Würzburg gab es ein Projekt mit drei Betroffenen, die ihre Geschichte erzählt haben – von anfänglichem Widerstand („Ich hab euch ja gehasst“) bis zur Erkenntnis, dass die Unterstützung ihnen das Leben gerettet und neue Lebensqualität geschenkt hat; ihre Erfolgsgeschichten sollen sowohl Betroffenen als auch zögerlichen Führungskräften Mut machen.
Mit solchen Formen von Aufklärungsarbeit können Organisationen das Tabuthema an alle Mitarbeiter*innen bringen. Das ist besonders wichtig, wenn Führungskräfte selbst betroffen sind. Von ihnen wird erwartet, Belastungen früh zu erkennen und schwierige Themen wie Sucht offen anzusprechen.
Doch wer sorgt eigentlich für die Führungskräfte? Je höher die Hierarchieebene, desto dünner wird das Netz. Hilfe muss dann aus dem Kolleg*innenkreis kommen, auch wenn dieser keinen disziplinarischen Druck ausüben kann. Umso wichtiger ist es, nicht nur Führungskräfte, sondern alle im Team durch Vorträge und Austausch zu sensibilisieren. So entsteht eine Kultur, in der Verantwortung und Fürsorge gemeinsam getragen werden.
Hilfsangebote
Was müssen und was können Teams tun?
Unfallverhütungsvorschriften
Jeder Arbeitgeber muss gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Seit 2013 müssen in dieser Beurteilung auch Risiken für psychische Belastungen gelistet werden.
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
In der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie gibt es „Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung“. Zweck der Beurteilung ist es, Arbeit so zu gestalten, dass die psychische Gesundheit möglichst geschützt wird (§ 5 Abs. 3 Nr. 6 ArbSchG).
Drogentests am Arbeitsplatz
Drogentests greifen stark in das Persönlichkeitsrecht und in das Recht auf körperliche Unversehrtheit (beide Art. 2 GG) ein. Sie sind nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt: bei sicherheitsrelevanten Berufen wie Pilot*in oder Busfahrer*in oder wenn der*die Arbeitnehmer*in freiwillig und ausdrücklich zustimmt. Ansonsten sind Tests auf Verdacht oder Stichprobentests ohne konkret kommunizierten Anlass unzulässig.
Interne Zuständigkeiten
Arbeitgeber sind nach ArbSchG verpflichtet, Gesundheitsgefährdungen zu verhindern und externe Fachkräfte (Betriebsärzt*innen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit) einzubeziehen.
- ab 20 Beschäftigten: Pflicht zur Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (§ 5 ASiG).
- ab mehr als 30 Beschäftigten: Wahl eines Betriebsrats (wenn die Mitarbeiter*innen das wollen), der bei Suchtprävention eine Rolle spielen kann
Arbeitsunfälle
Grundsätzlich sind Arbeitsunfälle über die gesetzliche Unfallversicherung (BG) abgesichert. Passiert der Unfall alkoholisiert oder unter dem Einfluss anderer Drogen, verstößt die Arbeitskraft gegen ihre Pflicht zur Arbeitstauglichkeit. Allerdings: Wenn der Arbeitgeber von einer substanzbezogenen Sucht weiß, muss er*sie den Vorfall als krankheitsbedingtes Verhalten einordnen und vorerst andere Maßnahmen als eine Kündigung ergreifen.
Takeaways
- Sucht ist eine weit verbreitete psychische Erkrankung, die auch am Arbeitsplatz sichtbar wird. Durch Stigmatisierung und falsche Vorstellungen über Eigenverantwortung bleibt vielen Betroffenen der Zugang zu Hilfe verwehrt.
- Belastende Arbeitsbedingungen können Suchtverhalten fördern. Eine offene Unternehmenskultur mit Aufklärung, psychologischer Sicherheit und Präventionsmaßnahmen kann das Risiko deutlich senken.
- Ein verantwortungsvoller Umgang mit Sucht am Arbeitsplatz braucht klare Strukturen und geschulte Kolleg*innen. Enttabuisierung, Prävention und ein verbindlicher Interventionsplan ermöglichen frühzeitige Hilfe.
Inputgeber*innen
Benthe Untiedt ist Beraterin bei Shitshow, einer Agentur für psychische Gesundheit. Neben Beratung und Workshops nutzt Shitshow erlebnisbasierte Tools wie eine Audio-Ausstellung, um für psychische Erkrankungen wie bspw. Sucht zu sensibilisieren.
Niels Pruin ist Suchttherapeut und Leiter des Fachgebiets Medien- und Internetsucht des Caritasverbandes der Diözese Augsburg e.V. Er bietet regelmäßig Workshops für Führungskräfte zur Erarbeitung einer innerbetrieblichen Präventionsstrategie an. Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind Substanzkonsum sowie Medien- und Computerspielsucht.
Katja Beck-Doßler ist geschäftsführende Leiterin der Sucht- und Konfliktberatungsstelle der Universität Würzburg. Sie berät seit 25 Jahren Führungskräfte und Mitarbeitende zur Prävention von Konflikten, psychischen Belastungen und Suchtproblemen am Arbeitsplatz.
FUßNOTEN
- 1
DAK: DAK Psychreport 2024: Erneuter Höchststand bei psychisch bedingten Fehltagen im Job (2024) ↩
- 2
Alkohol verursacht gesamtgesellschaftlich die meisten Folgeschäden. Laut Epidemiologischem Suchtsurvey 2021 wiesen 17,6 Prozent der Befragten einen krankhaften Alkoholkonsum, 21,9 Prozent einen risikobehafteten Konsum auf. ↩
- 3
Einen ausführlichen Artikel zum Thema Arbeitssucht findest du übrigens in unserer Ausgabe #19: Fokus (2023). ↩
- 4
manager-magazin.de: Der Pillenkick (2015) ↩
- 5
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. hat ein Handbuch zu „Qualitätsstandards in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe“ herausgegeben. ↩
- 6
Bei vielen Stellen wie der Notfallseelsorge ist diese Ausbildung sogar kostenlos. ↩
- 7
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: Der Stufenplan ↩