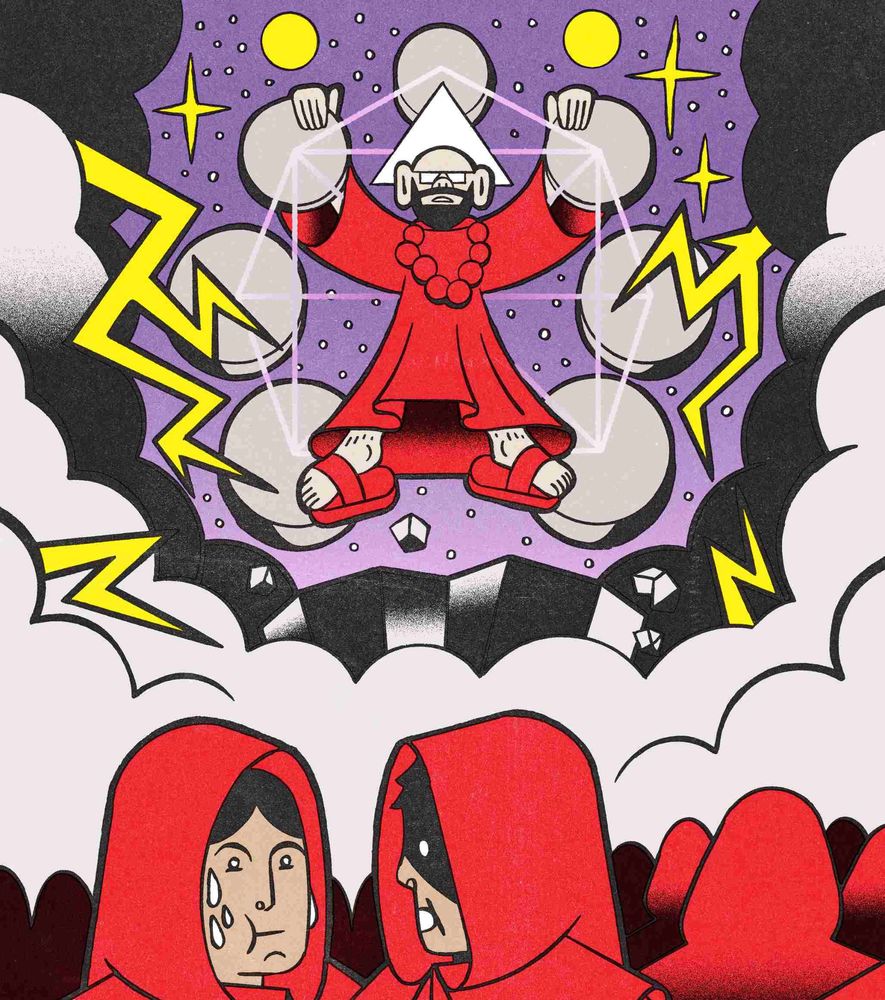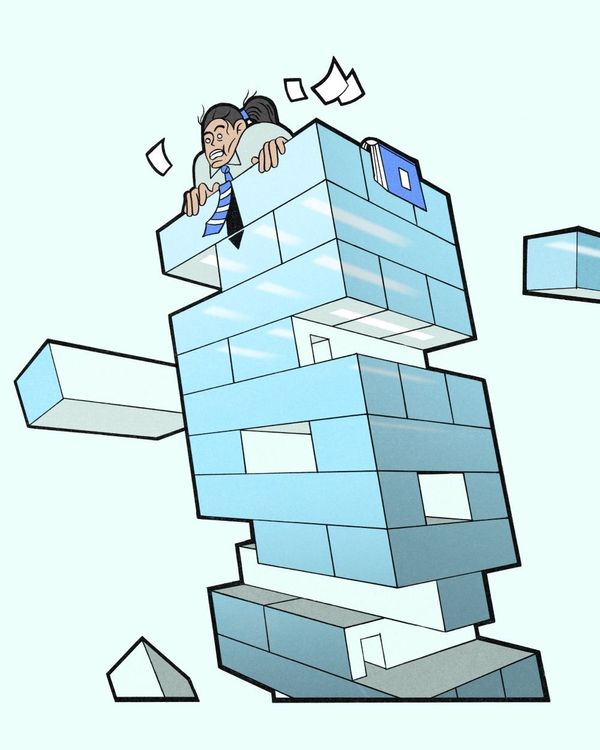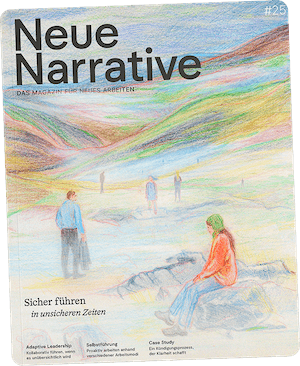Sprache ist unser wichtigstes Werkzeug in der Welt der neuen Arbeit. In dieser Kolumne zeigen wir, wie sie sich noch ein bisschen sinn- und verantwortungsvoller einsetzen lässt. Diesmal: Warum sich Teams nicht als Familie bezeichnen sollten.
In der erfolgreichen Comedy-Serie The Office spielt die Metapher der Familie eine zentrale Rolle. Michael Scott, Regionalleiter im Büro einer Papiervertriebsfirma, versucht seine Mitarbeiter*innen regelmäßig mit Büro-Partys, Bowling-Abenden und Verkleidungstagen zu bespaßen, um den Zusammenhalt im Team zu fördern. Das gelingt ihm aber nur selten und die Mitarbeiter*innen finden seine Versuche meist gar nicht lustig. Trotzdem probiert es Scott immer wieder und betont, dass sie doch eine Familie seien.
Wahrscheinlich ist die Serie auch deshalb so beliebt, weil sie widerspiegelt, was viele Menschen in der Realität erleben: Unternehmen, die sich als Familie verstehen – oft von Führungskräften initiiert, mal mehr, mal weniger erfolgreich, mal mit, mal ohne Absicht. Larry Page, Co-Founder von Google, sagte dazu in einem Interview1: „It’s important [...] that people feel that they’re part of the company, and that the company is like a family to them.“2
Auch wenn durch die Bezeichnung als Familie tatsächlich ein Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Organisation entstehen kann, gibt es einige gute Gründe dafür, dass Teams diesen Vergleich nicht ziehen sollten. Welche sind das und welche alternativen Begriffe gibt es?
„I feel like all my kids grew up, and then they married each other.“
Michael Scott (The Office)

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative
Magazin kostenlos lesenSechs Gründe dafür, dass Teams keine Familien sind
1. „Ich gebe, du nimmst.“
Ob klassische Kernfamilie, Regenbogenfamilie, Wahlfamilie oder alleinerziehende Eltern – wenn ich an funktionale Familien denke, denke ich an Unterstützung, Akzeptanz, Geborgenheit und, ganz wichtig, an Bedingungslosigkeit. Wir müssen nichts leisten, um Teil der Familie zu sein – wir sind es einfach und werden es auch immer sein.
Ganz anders die Organisationen, in denen wir arbeiten: Auch sie können uns zwar unterstützen und durch schwierige Zeiten begleiten, aber sich im beruflichen Kontext als Familie zu bezeichnen, schafft ein falsches Bild von Sicherheit und Bedingungslosigkeit. Als Arbeitnehmer*innen stehen wir in einem Abhängigkeitsverhältnis zum*zur Arbeitgeber*in. Wenn wir nicht die gewünschte Leistung erbringen, unvereinbare Vorstellungen über Strukturen, Prozesse oder Veränderungen haben oder es die finanzielle Lage erfordert, können wir entlassen werden. Unser Gehalt, unsere Arbeitsergebnisse, bezahlte Urlaubstage – das alles sind keine Geschenke, sondern Teil eines Tauschgeschäfts.
2. „Das kann ich ihm*ihr nicht sagen.“
Wertschätzendes und konstruktives Feedback nimmt in Organisationen einen immer höheren Stellenwert ein. Viele Teams haben feste Routinen, um sich regelmäßig gegenseitig Feedback zu geben. Vor allem für kritische Rückmeldungen ist jedoch auch eine gewisse emotionale Distanz nötig, um objektiv bleiben zu können. „Wird der Familienbegriff in einem Unternehmen stark etabliert, können Mitarbeiter unter Umständen ihren Arbeitgeber nicht mehr konstruktiv bewerten.“ 3
Das zieht dann weitere Probleme nach sich: Mitarbeiter*innen halten ihre Kritik zurück, Spannungen bleiben ungeklärt, die Zusammenarbeit wird zäh und unproduktiv. Sich als Familie zu bezeichnen, löst zudem Grenzen auf, die für selbstorganisiertes, spannungsbasiertes Arbeiten nötig sind. Wenn diese Grenzen zu sehr aufweichen, merke ich das etwa daran, dass ich mich scheue, einem*einer Kolleg*in, mit dem*der ich mich privat gut verstehe, mitzuteilen, dass mir etwas in seiner*ihrer Rolle fehlt. Genau dieses leistungsorientierte Feedback unterscheidet jedoch unsere Arbeitsbeziehungen von unseren familiären Beziehungen.
3. „Ich kann nicht mehr.“
Für die Familie gehen viele Menschen über ihre Grenzen hinaus. Sie trösten, unterstützen, pflegen und begleiten, und oft stellen sie dabei ihre eigenen Bedürfnisse hintenan. 4 Im Arbeitskontext entwickelt sich solch ein Verhalten leicht zu Aufopferung: Dann sehen wir Menschen, die Überstunden machen, Pausen vergessen oder Arbeit trotz Überlastung nicht an Kolleg*innen abgeben, um „Familienmitglieder“ nicht zu belasten.
Sich als Familie zu bezeichnen, kann zur Überidentifikation mit dem Unternehmen und seiner Mission führen und in der Folge zu Überarbeitung. Das Zitat von Larry Page geht noch weiter: „Wenn man die Leute so [wie Familie] behandelt, erhält man bessere Produktivität.“ 5 Das ist schon recht zynisch, denn im Grunde bedeutet es nichts anderes, als dass Google dazu rät, Mitarbeiter*innen wie Familienmitglieder zu behandeln, damit sie noch mehr Leistung bringen – Gemeinschaftlichkeit als Mittel, um Menschen zu Höchstleistungen anzutreiben.

4. „Muss ich mich jetzt öffnen?“
Teams, die sich als Familie bezeichnen, verbringen oft auch privat viel Zeit miteinander. Aus Mittagessen, Feierabendbieren und gemeinsamen Urlauben entstehen Freundschaften, in denen man sich von den angenehmen und nicht so angenehmen Entwicklungen im eigenen Leben erzählt. Grundsätzlich ist daran nichts falsch. Auch bei Neue Narrative versuchen wir, uns als ganze Menschen zu zeigen und das Bild aufzubrechen, dass Mitarbeiter*innen wie produktive Roboter funktionieren, die jederzeit leistungsfähig sind und keine Probleme haben.
Kritisch wird es allerdings, wenn es eine allgemeine Erwartungshaltung gibt, dass ich mich als Mitarbeiter*in öffne, von meinem Privatleben erzähle und regelmäßig nach Feierabend Zeit mit Kolleg*innen verbringe, obwohl ich das vielleicht nicht möchte. Diese Form der Zusammenarbeit ist nicht für alle Menschen stimmig. Manche wünschen sich mehr Privatsphäre und eine striktere Trennung von Arbeit und Privatleben. Sind sie dann automatisch kein Teil der Familie?
5. „Bei uns sind alle gleich.“
In einer Familie gilt im besten Fall der Grundsatz, dass alle Familienmitglieder gleich viel wert sind und gleichermaßen geliebt und akzeptiert werden. In einem Unternehmen sollte dieser Grundsatz auch gelten, kann aber nur bedingt eingelöst werden, denn nicht alle arbeiten unter den gleichen Bedingungen. So fühlen sich strukturell diskriminierte Menschen in Teams häufig nicht gleichwertig zugehörig, wenn diese zu einem Großteil aus Menschen bestehen, die ihre Diskriminierungserfahrungen nicht teilen. Aber auch andere Faktoren können dazu führen, dass wir uns mit den Menschen in unserem Team nicht verwandt fühlen. Diese Unterschiede werden durch den Familienbegriff verschleiert.
Spannend ist, dass Organisationen meist ein idealisiertes Familienbild verwenden: das der harmonischen, konstruktiven und positiven Familie, die immer füreinander da ist. Problematische Elemente wie die Tante, die ihre Wut über einen Konflikt nicht ausdrückt, oder der Bruder, dem wir auf Familienfeiern aus dem Weg gehen, werden in dieser Vorstellung ausgeklammert. Dabei ist die Konfliktkultur in vielen Familien, genau wie in Organisationen, alles andere als konstruktiv. Obwohl in Familien also selten absolute Harmonie herrscht, nutzen Unternehmen genau dieses Bild, um Harmonie herzustellen.
6. „Ich kann nicht kündigen.“
Unsere (biologische) Familie suchen wir uns bekanntlich nicht aus. Sie ist eine Bindung fürs Leben, unabhängig davon, ob wir miteinander in Kontakt stehen oder nicht. Bei einem Job ist das nicht der Fall. Die meisten Menschen haben im Laufe ihres Lebens mehrere Arbeitsplätze und wie eine Studie des Marktforschungsinstitut Gallup 6 zeigt, war die Bereitschaft zum Jobwechsel unter deutschen Arbeitnehmer*innen noch nie so hoch wie in den letzten Jahren. Ein Unternehmen als Familie zu begreifen, kann als Mittel genutzt werden, Menschen emotional an das Unternehmen zu binden und sie von der Kündigung abzuhalten, selbst wenn diese angebracht wäre.
Für die meisten Menschen stellt eine Kündigung schon für sich genommen eine Herausforderung dar, weil sie mit dem Verlust von beruflicher Sicherheit einhergeht. Der Familienbegriff erzeugt Gefühle von Verpflichtung und langfristiger Bindung, sodass bei einer Kündigung nun auch noch der Verlust der „Familie“ als zusätzliche Belastung hinzukommt. Doch fest steht: Wenn uns unser Job schadet, können und sollten wir uns von ihm trennen und uns einen anderen suchen – er ist keine Bindung fürs Leben.
Obwohl in Familien selten absolute Harmonie herrscht, nutzen Unternehmen genau dieses Bild, um Harmonie herzustellen.
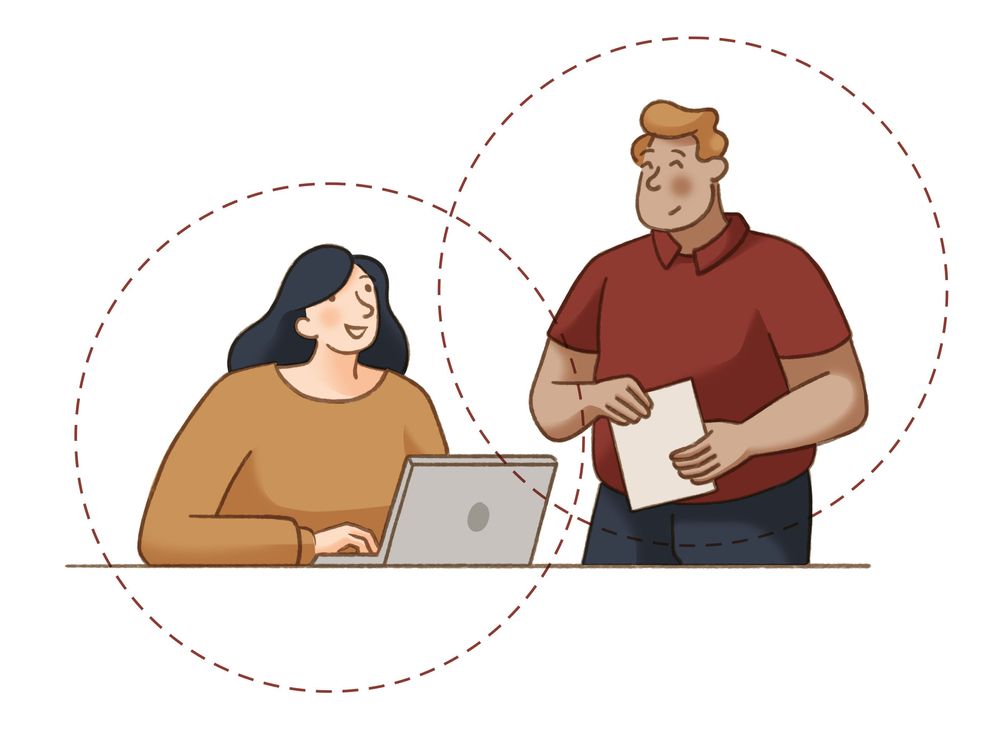
Die passende Metapher finden
Eine Metapher kann ein tolles Bindemittel sein, um Teams stärker zusammenzubringen – es muss aber die richtige sein. 7 Wichtig dabei ist, keine problematischen Assoziationen zu wecken, wie es beim Familienbegriff der Fall sein kann. Jede Organisation sollte für sich ein eigenes Bild finden, mit dem sie sich identifiziert. Dabei können folgende Fragen helfen: Welches Bild motiviert uns als Team? Welche Metapher passt zu unseren Werten und unserer Organisationskultur? Wie lässt sich unsere Dynamik, unsere Mission oder unsere Vision in einem Wort beschreiben? Und welche marginalisierten Gruppen könnten sich durch das Wort ausgeschlossen fühlen? Vielleicht kommt ihr auch zu dem Schluss, dass ihr keine gemeinsame Metapher braucht – auch das ist in Ordnung.
Unser Team bei Neue Narrative stelle ich mir manchmal wie ein Schnellboot vor: Wir sind als Team gemeinsam an Bord und navigieren durch die Gewässer. Jede*r hat seine*ihre Aufgabenbereiche, manche davon bewältigen wir gemeinsam, andere allein, aber jede*r leistet einen wichtigen Beitrag. Manchmal ist die See glatt und es gibt Rückenwind, an anderen Tagen ist sie stürmisch und das Fahren erfordert mehr Kraft. Wir unterstützen uns gegenseitig für die Zeit, in der wir gemeinsam an Bord sind. Wenn wir einen Hafen anlaufen, kann es sein, dass uns Teammitglieder verlassen und neue Menschen hinzukommen, bevor wir auf die nächste Reise gehen.
Eine Metapher kann ein tolles Bindemittel sein, um Teams stärker zusammenzubringen – es muss aber die richtige sein.
FUßNOTEN
- 1
Adam Lashinsky: Larry Page: Google should feel like a family (2012) ↩
- 2
Übersetzung: „Es ist wichtig, [...] dass sich die Mitarbeiter*innen als Teil des Unternehmens fühlen und dass das Unternehmen für sie wie eine Familie ist.“ ↩
- 3
Samira Helbig: „Wir sind eine große Familie“ – warum diese Chef-Floskel problematisch ist (2020) ↩
- 4
Nicht immer geschieht dies aus freien Stücken. Im besten Fall ist Hingabe für die Familie eine zwischen Eltern, Angehörigen und Geschlechtern verhandelte bewusste Entscheidung. ↩
- 5
Originalzitat: „When you treat people that way, you get better productivity.“ Übersetzung: „Wenn man die Menschen so behandelt, ist die Produktivität höher.“ ↩
- 6
Claudia Tödtmann: Jobwechsel? Ja gern! Die Great Resignation erreicht Deutschland (2022) ↩
- 7
Samira Helbig: „Wir sind eine große Familie“ – warum diese Chef-Floskel problematisch ist (2020) ↩